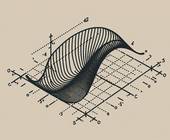UK verlässt die EU
30.01.2020, 11:01 Uhr
Brexit: Was Online-Händler jetzt beachten müssen
Zoll, Markenrecht, Datenschutz - der Austritt Grossbritanniens aus der EU stellt Online-Händler vor grosse Herausforderungen. Doch wer sich auf das Schlimmste vorbereitet, kann vielleicht gestärkt aus dem Brexit hervorgehen.
Chris Dawson, Mitbegründer und Chefredakteur des britischen E-Commerce-Fachportals Tamebay, übte sich in Sarkasmus. Anlässlich eines Webinars zum Thema Brexit zwei Wochen vor dem geplanten Austrittstermin Grossbritanniens aus der EU schätzte er die Gemütslage seiner Landsleute folgendermassen ein: "Die Hälfte derer, die damals für den Brexit gestimmt hat, hat heute ihre Meinung geändert, weil sie sich belogen fühlt. Und die Hälfte derer, die damals für den Verbleib in der EU gestimmt hat, will heute einen Austritt, damit das Drama endlich einmal zu Ende ist."
Ob der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland (UK) das Ende eines Dramas sein wird oder erst dessen Beginn, darüber gibt es auch unter Experten unterschiedliche Ansichten. Aber er ist beschlossen: Am 22. Januar ratifizierte das britische Unterhaus das Brexit-Abkommen mit der EU, nachdem die vom Oberhaus vorgeschlagenen Änderungen zurückgewiesen worden waren. Am 31. Januar 2020 verlässt das Königreich die Union.
Danach ist eine Frist bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen, in der UK zwar kein EU-Mitglied mehr ist, ansonsten allerdings fast alles so bleibt wie bisher, inklusive der Freizügigkeit von Geld, Waren und Menschen. Diese elf Monate sollen mit dem Abschluss eines Handelsabkommens enden, das die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen der beiden Partner regelt. Experten halten das für völlig illusorisch. Steffen Morawietz, auf E-Commerce spezialisierter Anwalt bei der Kanzlei Eversheds Sutherland, verweist auf andere grosse Handelsabkommen wie TTIP oder EFTA, die Jahre des Verhandelns brauchten, teilweise gar Jahrzehnte. Am Ende des Jahres könnte also eine weitere Fristverlängerung stehen - oder der No-Deal-Brexit, ein Austritt Grossbritanniens ohne Austrittsabkommen.
Nach einem No-Deal-Brexit gelten die WTO-Regeln
Selbst dann, so sagt Bobbie Ttooulis, fiele UK nicht ins Bodenlose. Wenn es keinen Deal zwischen den beiden Parteien gibt, dann greifen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO, erklärt die Handelsexpertin des britischen Frachtdienstleisters Global Freight Solutions (GFS). Die EU ist als Union WTO-Mitglied, UK verfügt über eine eigene WTO-Mitgliedschaft. Damit, so Ttooulis, seien die grundsätzlichen Fragen des bilateralen Handels geklärt. Dennoch bedeutet Handel nach WTO-Standards mehr Aufwand als der bisherige Handel im gemeinsamen Markt der EU. Die britischen Onlinehändler, so Ttooulis' dringender Rat, sollten vom "Worst Case Scenario" ausgehen, also einem No-Deal-Brexit. Die verbleibende Zeit bis Jahresende müssten sie nutzen, um sich auf einen Aussenhandel nach WTO-Spielregeln vorzubereiten.
Aus Sicht der Logistik-Fachfrau sind dies vor allem Fragen, die sich um den Zoll und die Warenabfertigung an der Grenze drehen - und die Händler vom Festland genauso betreffen, wenn sie nach einem eventuellen No-Deal-Brexit weiterhin Waren nach Grossbritannien liefern wollen. Für Unternehmen, die bislang noch nicht ausserhalb des EU-Binnenmarkts verkauft haben, bedeutet dies zum Beispiel, dass sie eine EORI-Nummer (Economic Operators' Registration and Identification Number) benötigen. Das ist eine von den Zollbehörden vergebene Nummer, die zur Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten und gegebenenfalls anderen Personen gegenüber den Zollbehörden dient, also quasi eine Steuer-ID für den Zoll.
Dutzende Zollcodes - allein für Schuhe
Deutlich aufwendiger ist die Generierung der sogenannten HS-Codes. Das Harmonized Commodity Description and Coding System, kurz HS Code, ist ein weltweit verbreiteter Standard zur Beschreibung der Art der Ware, die versandt wird. Jede Ware, die internationale Grenzen erreicht oder überschreitet, muss mit diesem Code beim Zoll angemeldet werden. Händler, die mit diesem System nicht vertraut sind, sollten dessen Komplexität auf keinen Fall unterschätzen, denn allein für Schuhe und ihre Komponenten gibt es mehr als ein Dutzend Codes, die die verschiedenen Bestandteile des Produktes beschreiben. Wer mehrere Tausend verschiedene Artikel im Sortiment hat, sollte gegebenenfalls einen Dienstleister zurate ziehen, der bei der Katalogisierung hilft, ansonsten ist Stress beim Zoll vorprogrammiert.
Bis zum Ablauf der Übergangsfrist sollten Unternehmen ausserdem sämtliche eingesetzten IT-Systeme, Software- und Hardware-Tools darauf überprüfen, ob sie in der Lage sind, zollrelevante Informationen reibungslos zu verarbeiten, entsprechende Daten zu empfangen und an andere Systeme zu übergeben. Fachfrau Ttooulis dazu: "Das geht bis hin zum Label-Drucker, der die entsprechenden Formate beherrschen muss." Damit ist die Arbeit noch nicht getan: Sämtliche am Auslandsversand beteiligten Dienstleister müssen intensiv darauf überprüft werden, ob sie mit den Zollregularien gemäss WTO vertraut sind. Denn ab 1. Januar 2021 müssen alle Prozesse reibungslos laufen, sonst droht das grosse Chaos.
Doch das Überwinden der Zollschranken ist nur ein erster Schritt. Denn das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung innerhalb der EU gilt nach dem Brexit für UK nicht mehr. Bislang, so erklärt Anwalt Morawietz, gilt in der EU, dass Waren, die den Bestimmungen eines EU-Landes genügen, auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten legal verkauft werden dürfen. UK gilt nach dem Brexit als Drittstaat. Damit ist jeder Händler, der Ware nach UK liefert, dafür verantwortlich, dass diese Ware auch den dort gültigen Bestimmungen entspricht. Als Beispiel nennt Morawietz das Medizinprodukterecht: "Die Apple Watch hat eine EKG-Funktion, die in den USA von den Gesundheitsbehörden als medizinisches Gerät zugelassen wurde. In der EU fehlte eine Zertifizierung zunächst, deshalb musste die Apple Watch hierzulande anfangs ohne diese Funktion verkauft werden." Umgekehrt gilt das Prinzip ebenfalls: Unternehmen, die Ware in UK einkaufen und in der EU vertreiben, gelten in Zukunft als "Inverkehrbringer" - und sind damit selbst verantwortlich dafür, dass die Ware von der Insel allen EU-Bestimmungen entspricht.
Nach dem Brexit gilt die DSGVO in England nicht mehr
Noch ungeklärt ist die Situation beim Thema Datenschutz. Die DSGVO, die den Datenschutzrahmen in der Union definiert, ist eine EU-weite Verordnung. Das bedeutet: Als die DSGVO am 24. Mai 2016 in Kraft trat, war sie sofort in allen Mitgliedsstaaten gültig, auch ohne dass sie durch nationale Gesetze umgesetzt werden musste. Nach einem Brexit gilt die DSGVO in UK nicht mehr, stattdessen treten wieder die Datenschutzgesetze in Kraft, die in Grossbritannien vorher gültig waren. Die direkte Folge: Da Grossbritannien in diesem Fall als sogenannter Drittstaat gilt, dürfen deutsche Unternehmen keine personenbezogenen Daten mehr von UK-Dienstleistern verarbeiten oder speichern lassen. Dies könnte die EU-Kommission durch einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss ändern. Ein solcher würde dem dann gültigen UK-Datenschutzrecht ein Niveau zuerkennen, das der DSGVO entspricht. Solche Beschlüsse hat die EU-Kommission in der Vergangenheit bereits getroffen, zum Beispiel zuletzt für das japanische Datenschutzrecht im Jahr 2019. Wann sie dies in Bezug auf UK tun wird, ist allerdings ungewiss.
Einen Ausweg aus dieser Problematik weisen die sogenannten Standarddatenschutzklauseln, die die EU-Kommission erlassen hat. Dabei handelt es sich um vorformulierte Datenschutzverträge, die ein Datenschutzniveau sicherstellen sollen, das mit der DSGVO vereinbar ist. Unternehmen mit Sitz in der EU, die kritische Daten von Dienstleistern in Drittstaaten verarbeiten lassen, können diese Vertragsklauseln - selbstverständlich unverändert - in die Verträge mit diesen Dienstleistern aufnehmen, um die personenbezogenen Daten rechtssicher übermitteln zu können.
Einfacher stellt sich die Situation bei den ebenfalls EU-weit geregelten Verbraucherrechten im Fernabsatz dar. Die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie (EU-VRRL) ist nämlich im Gegensatz zur DSGVO keine Verordnung, sondern eine Richtlinie. Sie gilt nicht unmittelbar, sondern musste bis Juli 2014 in allen EU-Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt werden - auch in UK. Nach einem Brexit werden die entsprechenden Gesetze in UK weiter Gültigkeit haben, und Anwalt Morawietz geht nicht davon aus, dass der politische Wille in UK besteht, den Verbraucherschutz zu verschlechtern. Zudem verweist er darauf, dass viele Regeln der EU-VRRL ohnehin der gängigen Marktpraxis entsprechen: "In der Schweiz gilt zum Beispiel das EU-Widerrufsrecht nicht. Dennoch wird es von allen relevanten Händlern auf freiwilliger Basis eingeräumt."
Handlungsbedarf besteht für viele Unternehmen beim Umgang mit Marken und Markenrechten. Wer für seinen Firmen- oder Produktnamen eine EU-Gemeinschaftsmarke angemeldet hat, steht in UK demnächst ohne Markenschutz da und muss gegebenenfalls eine nationale UK-Marke anmelden. Eine Alternative wäre eine IR-Marke, die weltweit geschützt ist.
Unerwartetes Hindernis für den Online-Handel
Einen echten Fallstrick hält das Markenrecht für Unternehmen bereit, die Produkte aus der EU in Drittländern verbreiten. Grundsätzlich hat nämlich jeder Markeninhaber das Recht, selbst zu entscheiden, wer seine Marke wie nutzt - zum Beispiel indem er dessen Produkte verkauft. Innerhalb der EU gilt jedoch das Prinzip der "gemeinschaftsweiten Erschöpfung“. Das bedeutet: Ist ein Produkt innerhalb der EU erst einmal legal in den Handel gekommen, sind die Rechte des Herstellers an der Marke insofern erschöpft, als er nicht mehr darüber bestimmen kann, wer seine Ware innerhalb der EU weiterverkauft.
Das bedeutet, dass ein deutscher Händler Markenprodukte auch dann ohne Zustimmung des Herstellers verkaufen darf, wenn er sie zum Beispiel nicht von dessen deutschen Distributor gekauft hat, sondern vom einem Zwischenhändler in Spanien. Sobald der Bezugs- oder der Absatzort sich ausserhalb der EU befindet, gilt die gemeinschaftsweite Erschöpfung nicht mehr. Dies mussten in den 90er-Jahren Grauimporteure erfahren, die den in Mexico gebauten VW Beetle in den USA einkauften und in Deutschland anboten. Der Volkswagen-Konzern verklagte die Importeure wegen Markenrechtsverletzung.
Umgekehrt gilt das Prinzip auch: Ein deutscher Händler, der Ware bei einem deutschen Hersteller einkauft und in ein Drittland ausserhalb der EU verkauft, kann sich dabei nicht auf die gemeinschaftsweite Erschöpfung der Markenrechte innerhalb der EU berufen. Der Hersteller könnte den Händler verklagen und neben Unterlassung auch Schadensersatz fordern. Fiktives Beispiel für Nach-Brexit-Zeiten: Ein deutscher Hersteller von Luxuskameras betreibt in UK einen selektiven Vertrieb. Ein deutscher Händler besorgt sich in der EU Kameras dieses Herstellers und bietet sie online in UK an. Das wäre dann eine Verletzung der Kameramarke - und könnte teuer werden.
Hohe Kosten kommen auf Unternehmen zu, die sich aus Steuergründen eine britische Rechtsform gegeben haben. Vor allem bei Anwaltssozietäten beliebt ist zum Beispiel die LLP (Limited Liability Partnership), auch die britische Ltd. (Limited Company, das Äquivalent zur GmbH) oder die PLC (Public Limited Company) wurde auch auf dem Kontinent häufig gewählt.
Laut EU-Recht müssen Unternehmen, die in der Gemeinschaft tätig sind, jedoch eine Rechtsform haben, die in der EU gebräuchlich ist. Das könnte auf die genannten Beispiele bald nicht mehr zutreffen. Brexit-Rechtsexperte Morawietz beobachtet deshalb einen Trend hin zu Rechtsformen, die in Luxemburg oder den Niederlanden gebräuchlich sind: zum Beispiel die Aktiengesellschaft (S.A.), die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (S.à r.l.) oder die holländische b.V., die der deutschen GmbH entspricht.
Allerdings gilt das Prinzip auch andersherum. Ein Unternehmen, das künftig sowohl in der EU als auch in UK tätig sein will, benötigt zusätzlich zur EU-Rechtsform eine zweite Firmeneintragung nach UK-Regularien.
Vorbereiten auf das Schlimmste
Solange noch nicht feststeht, wie sich die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen UK und EU entwickeln werden, sollten sich Händler in der EU auf das Schlimmste vorbereiten: einen No-Deal-Brexit ab dem 1. Januar 2021. Danach würde der Aussenhandel mit Grossbritannien grundsätzlich nach den gleichen Regeln abgewickelt, die heute für ein Land wie Uganda gelten.
Logistikexpertin Ttooulis kann dieser möglichen Entwicklung dennoch positive Seiten abgewinnen. Ein britischer Händler, der seine gesamte Lieferkette auf die WTO-Regularien abstimmt, um auch zukünftig in die EU liefern zu können, so argumentiert sie, schaffe damit die Voraussetzungen für problemlosen Handel mit jedem der mehr als 164 anderen WTO-Mitgliedsländer. Damit eröffneten sich Expansionspotenziale in Märkte, die sich vielfach dynamischer entwickelten als die EU: "Das 'Worst Scenario‘ könnte sich vielleicht zum 'Best Scenario‘ für viele britische Händler entwickeln."
Ob Ttoouilis recht behält, muss die Zukunft zeigen. Aber diese Chance würde nicht dann nur britischen Händlern offenstehen, sondern auch denen in der EU.