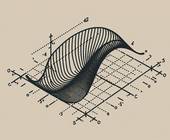Upload-Filter
08.07.2019, 14:54 Uhr
Urheberrechtsreform: Der Paradigmenwechsel
Am 26. März 2019 nahm das EU-Parlament den Entwurf für eine neue EU-weite Urheberrechtsrichtline an. Sie ändert grundsätzliche Haftungsregeln im Internet. Wie stark sich das in der Praxis auswirken wird, ist heute noch nicht absehbar.
Im Vorfeld der Abstimmung im EU-Parlament hatte Wikipedia Deutschland aus Protest einen Tag lang die Arbeit eingestellt.
(Quelle: Screenshot Wikipedia)
Steht das Ende des Internets, wie wir es kennen, unmittelbar bevor? Diesen Eindruck vermittelten zumindest die Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern der EU-Urheberrechtsreform, die am 26. März 2019 vom EU-Parlament angenommen wurde. Die Gegner des Vorhabens sparten nicht mit massiver Kritik. So fragte beispielsweise der Netzerklärer der Republik, Sascha Lobo, in seiner wöchentlichen Kolumne auf "Spiegel Online": "Wollt ihr Europa zerstören? Denn genau so zerstört ihr Europa. Durch visionslose, bigotte, lobbyhörige Politik, heute am Beispiel der Urheberrechtsreform." Zu Zehntausenden gingen Menschen auf die Strasse und demonstrierten für "ihr Internet". Am 21. März, wenige Tage vor der Abstimmung in Brüssel, stellte gar die deutsche Wikipedia-Seite für einen Tag die Arbeit ein und zeigte stattdessen einen Protestaufruf.
Vor allem in Deutschland erreichten die Proteste Ausmasse, die für ein Netz-Thema aussergewöhnlich sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass zwei politische Akteure auf EU-Ebene den Diskurs prägten, die beide Deutsche sind: der EVP-Abgeordnete Axel Voss (CDU) und Julia Reda, die bislang für die Piratenpartei im EU-Parlament sass.
Die 32-Jährige wurde 2014 vom Rechtsausschuss des EU-Parlaments als Berichterstatterin für die Umsetzung der EU-Urheberrichtlinie von 2001 bestimmt. Voss, 56 Jahre alt und seit 1996 CDU-Mitglied, hat diese Funktion für die aktuellen Verhandlungen um die Richtlinie inne. Eine richtig gute Figur machten weder der Konservative Voss noch die Piratin Reda. Voss erntete einen Shitstorm von epischen Ausmassen, nachdem er Gegner der Richtlinie als ferngesteuerte Bots beschimpft hatte. Reda beendete ihre politische Karriere nur einen Tag nach der Abstimmung, indem sie die Piraten verliess - und öffentlich davon abriet, diese Partei zu wählen.
Urheber, Verleger und die Internet-Giganten
Doch worum geht es genau in der "Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt", die das EU-Parlament mit 348 Ja-Stimmen bei 274 Gegenstimmen und 36 Enthaltungen angenommen hat? Die Richtlinie, die seit Mai 2016 beraten wird, ersetzt einen Vorläufer aus dem Jahr 2001 und dient dazu, das Urheberrecht EU-weit zu harmonisieren. Im Gegensatz zu einer EU-Verordnung (etwa die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) gilt die Urheberrechtsrichtlinie nicht unmittelbar, sie muss erst noch von jedem Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden. Dafür haben die Länder zwei Jahre Zeit. Deutschland muss also das aktuell gültige Urheberrecht bis spätestens Ende März 2021 an die EU-Richtlinie angepasst haben, sonst droht ein blauer Brief aus Brüssel.
Bei der Umsetzung haben die Länder Spielräume, erklärt Anwältin Sabine Heukrodt-Bauer von der Medienrechtskanzlei Res Media in Mainz: "Der Text der Richtlinie enthält 'Ist-Vorschriften' und 'Soll-Vorschriften‘." "Ist-Vorschriften" sind solche, bei denen Formulierungen wie „Ist umzusetzen“ verwendet werden, bei "Soll-Vorschriften" wird eher ein gewünschtes Ziel vorgegeben, etwa mit den Worten "Soll erreicht werden". Daraus folgt für die Medienanwältin: "Manche Bestimmungen müssen genauso in nationales Recht umgesetzt werden, wie es die Richtlinie vorgibt, bei manchen ist das Land relativ frei in der Umsetzung."
Erklärtes Ziel der Richtlinie ist es, das Urheberrecht an die Rahmenbedingungen einer digitalen Gesellschaft anzupassen. Die Vorgängerrichtlinie stammt aus dem Jahr 2001 - Google war damals noch ein relativ unbekanntes Start-up. Facebook gab es noch nicht, Youtube ebenfalls nicht. Heute gelten diese Internet-Giganten vielen als die Hauptbedrohung für das Urheberrecht. In einer Presseerklärung des EU-Parlaments heisst es dann auch ganz unverblümt: "Die Richtlinie soll sicherstellen, dass die seit langer Zeit bestehenden Rechte und Pflichten des Urheberrechts auch für das Internet gelten. Direkt betroffen sind Internet-Plattformen wie Youtube, Facebook und Google News." Sie alle leben davon, Inhalte zu veröffentlichen, die sie nicht selbst erstellt haben - und bei denen die Urheberrechte oft nicht geklärt sind.
Die Richtlinie kehrt ein Haftungsprinzip um
Um die Rechte der Urheber gegenüber den Internet-Giganten zu stärken, kehrt die EU-Richtlinie ein Haftungsprinzip um. Haftete bislang ein Website-Betreiber für Urheberrechtsverstösse erst ab Kenntnis, ist er künftig verpflichtet, vor der Veröffentlichung von Inhalten auf seiner Website aktiv dafür zu sorgen, dass nichts ins Netz kommt, zu dessen Nutzung der Betreiber nicht berechtigt ist. Dies gilt bei Plattformen auch für Inhalte, die Dritte hochladen. Artikel 13 der Richtlinie, der im finalen Text plötzlich zu Artikel 17 wurde, schreibt explizit vor, dass dabei Mechanismen zu nutzen sind, die "hohen branchenüblichen Standards für die berufliche Sorgfalt" entsprechen, denn eine manuelle Kontrolle ist bei grossen Plattformen unrealistisch. Im Klartext: Grosse Portale müssen Upload-Filter einsetzen.
An diesen Filtern entzündete sich der Streit: Kritiker bezweifeln, dass ein Filteralgorithmus zuverlässig zwischen Bildern, Texten und Tönen unterscheiden könne, die urheberrechtlich unbedenklich sind – und solchen, die es nicht sind. Auch Medienanwältin Heukrodt-Bauer, als Juristin von Berufs wegen mit einem kühlen Blick gesegnet, befürchtet Ungemach: "Upload-Filter werden sicherlich dazu führen, dass Dinge, die eigentlich urheberrechtlich unbedenklich sind, nicht veröffentlicht werden. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt." Dass Artikel 17 so scharf umgesetzt wird, wie er in der Richtlinie steht, sei anzunehmen: Bei ihm handele es sich um eine "Ist-Vorschrift".
Muss in Zukunft jeder Online-Händler einen teuren Upload-Filter installieren, damit er nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt, wenn einmal ein Leser ein Foto in der Kommentarspalte hochlädt? Nach bisherigem Kenntnisstand eher nicht, denn die Richtlinie hat diese Verpflichtung der Vorzensur nur solchen Plattformen auferlegt, deren hauptsächlicher Geschäftszweck das Verbreiten von Werken ist, die andere dort hochladen. Zusätzlich sind Unternehmen ausgenommen, die kürzer als drei Jahre am Markt sind, weniger als zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr machen und unter fünf Millionen Nutzern haben. Diese drei Bedingungen hören sich jedoch grosszügiger an, als sie sind, meint Heukrodt-Bauer: "Sie gelten voraussichtlich nur für Unternehmen, die alle drei Bedingungen erfüllen, nicht nur eine davon."
Ebenfalls ausgenommen von der Filter-Pflicht sind offene Enzyklopädien wie Wikipedia, was den eingangs erwähnten Warnstreik der deutschen Wikipedia-Seite etwas übertrieben wirken lässt – die britische Version war am 21. März weiterhin online. Allerdings befürchten die deutschen Autoren der Online-Enzyklopädie eine allgemeine Verarmung des Informationsangebots im Netz, wenn bestimmte Inhalte aus Angst vor Ungemach nicht mehr hochgeladen werden - oder wenn ein übermotivierter Filteralgorithmus nicht zwischen einem urheberrechtlich geschützten Original und einer Parodie unterscheiden kann. Wer jemals Zeuge eines Urheberrechtsprozesses war, weiss, wie dünn - und interpretationsbedürftig - die Linien zwischen erlaubt und verboten in der Praxis oft sind. Dass eine Software in Millisekunden das entscheidet, wofür Gerichte oft Wochen brauchen, erscheint in diesem Zusammenhang ambitioniert.
Sind die Filter bei Facebook, Instagram und Youtube erst einmal installiert, könnten auch Social Media Manager und Online-Werber die Tücken des Objekts zu spüren bekommen. Was, wenn die Software einen Content mit Hinweis auf ein nicht näher spezifiziertes Urheberrechtsproblem ablehnt? Die Art und Weise, wie Facebook heute mit Bildern umgeht, die dem selbst auferlegten Moralkodex des Unternehmens zuwiderlaufen, gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf.
Das Leistungsschutzrecht ist beschlossene Sache
Den Initiatoren der EU-Richtlinie geht es aber nicht nur darum, die rechtswidrige Nutzung von urheberrechtlich geschützten Materialien zu verhindern. Die für alle Beteiligten profitablere Variante wäre es, solche Inhalte zu lizenzieren. Google und Co. könnten also - so die Logik hinter der Richtlinie - einfach Lizenzabkommen mit den Rechteinhabern abschliessen und so den Autoren, Fotografen und Künstlern, aber auch den beteiligten Verlagen ihren gerechten Anteil zukommen zu lassen. Das Stichwort dazu lautet Leistungsschutzrecht.
Vor allem deutsche Medienhäuser fordern schon lange ein solches Schutzrecht, sie wollen daran beteiligt werden, dass Google Inhalte ihrer Artikel veröffentlicht und so als News-Aggregator Geschäfte macht mit Content, den das Unternehmen nicht selbst geschaffen hat. Entsprechend positiv fiel deshalb die Reaktion der Verlegerverbände VDZ und BVZD aus. In einer Stellungnahme heisst es: "Die Zustimmung zur Reform ist ein 'ja' zur digitalen Zukunft von Kultur und Medien und zu einer lebendigen und vielfältigen Kreativlandschaft in Europa.“ Für viele Internet-Aktivisten geht dieser Ansatz völlig am Geist des Internets vorbei. Sie gehen davon aus, dass alles, was im Netz steht, auch frei weiterverarbeitet werden kann.
Die Verleger argumentieren, dass sie nicht anders gestellt werden wollen als Musiker oder Autoren. Für sie gibt es bereits seit Jahrzehnten Verwertungsgesellschaften, die Tantiemen einsammeln und an die Wahrnehmungsberechtigten ausschütten. Dabei lebt eine VG Wort von Beiträgen, die Hersteller von Kopierern, Scannern und Druckern für jedes Gerät abführen. Damit sind die Tantiemen für Texte, die mit solchen Geräten kopiert werden, quasi pauschal beglichen, und die Autoren freuen sich über ein Zubrot. Ähnlich verfährt die Gema, die in Deutschland rund 10.000 Musiker und Filmemacher vertritt. Wer in der Öffentlichkeit Musik- oder Filmdarbietungen zugänglich macht, muss zahlen - und die Gema gibt das gesammelte Geld an die Künstler weiter.
Wie schlecht dieses System in der digitalen Welt funktioniert, zeigen die Online- und die Gesamtumsätze der Musikverwertungsgesellschaft: Während die Gema insgesamt pro Jahr rund eine Milliarde Euro an Tantiemen einnimmt - überwiegend bezahlt von Plattenfirmen, TV- und Radiostationen sowie von Diskotheken und Konzertveranstaltern, kommen davon nur bescheidene 70 Millionen Euro - also weniger als sieben Prozent - aus dem Online-Bereich.
Das Verhältnis zwischen Gema und Youtube gibt auch einen Vorgeschmack darauf, wie sich ein Leistungsschutzrecht im Internet gestalten könnte: in erster Linie zeitaufwendig und mühsam. Nachdem ein Vertrag zwischen der Videoplattform und der Verwertungsgesellschaft 2009 ausgelaufen war und man sich auf keine weiterführende Regelung einigen konnte, begann Youtube, die Ausspielung von Videoclips von Urhebern zu sperren, die von der Gema vertreten wurden. Es sollte weitere sieben Jahre, mehrere Gerichtsprozesse und Abmahnungen dauern, bis beide Seiten schliesslich im Jahr 2016 eine Einigung über eine Vergütung für Gema-Material auf Youtube verkünden konnten.
Mehr Geld für Autoren, Künstler und Verlage
Ein postuliertes Ziel der EU-Richtlinie, nämlich den Journalisten, Autoren und Künstlern mehr Tantiemen an der Online-Nutzung ihrer Werke zukommen zu lassen, könnte für die Digitalwirtschaft Fluch und Segen zugleich sein. Denn die bisherigen Erfahrungen mit den Verwertungsgesellschaften zeigen, dass sie alles andere als unbürokratisch arbeiten - Wahrnehmungsberechtigte der VG Wort können ein Lied davon singen, wie kompliziert das Meldeverfahren ist. Dazu kommt, dass die grossen Verwertungsgesellschaften in ihrer Struktur Monopolisten gleichen, ein Nachteil sowohl für Urheber als auch für potenzielle Nutzer.
Ein Urheberrecht, das in erster Linie darauf abzielt, eine unbefugte Nutzung zu bestrafen, springt aber zu kurz. Denn wenn man sieht, wie lange Verhandlungen zwischen grossen Plattformen und grossen Verwertungsgesellschaften brauchen, bis eine Einigung auf einen Modus Vivendi erzielt ist, dann sieht es nicht gut aus für den mittelständischen Shop-Betreiber, der mal schnell eine Lizenz für ein Lied oder ein paar Fotos braucht, die er im Netz gefunden hat und gern weiterverwenden würde.